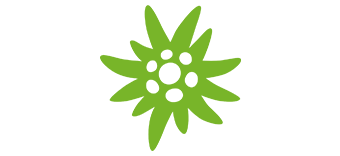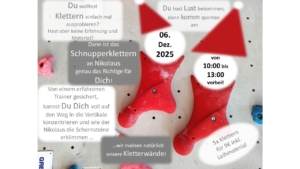Am vergangenen Sonntag fand im Rahmen einer Sektionstour bei besten
Schneeverhältnissen die Tour „Panoramaweg Ultralight“ statt. Die Winterwanderung war von Hartmut Thiel unserem Wanderleiter für Bergwandern ausgeschrieben.
Nach den turbulenten Wetterkapriolen der letzten Tage zeigte sich der Sonntag
von der besten Seite: “Frau Holle“ ließ es leise rieseln, und so wurden wir von
einer weißen, friedlichen Winterlandschaft rund um Baden-Baden angenehm
überrascht!
Unsere Tour begann um 9.00 Uhr mit dem Aufstieg in Lichtental, vorbei an den
Leisberg-Staffeln, ging es auf schmalen und leicht ansteigenden Pfad in
Richtung Leisberg. Nach etwa einer Stunde Gehzeit an der Gelbeichhütte
angekommen, wurde der Schnee immer tiefer und das Laufen ging mehr und mehr
in Stapfen über. Spätestens jetzt ärgerten wir uns über die fehlenden Schneeschuhe. Diese wären wirklich optimal gewesen.
Nach einer kleinen Teepause ging es dann im tiefen Schnee weiter über die Louisenfelsen in Richtung Batscharihütte, von wo aus man einen schönen Rundumblick auf die Kurstadt genießen kann. Die vom Wetterbericht angekündigte Sonne tat sich leider etwas schwer, nur vorübergehend waren kleine blaue Flecken am Himmel zu sehen. Zu einem kleinen Mittags-Snack hatte Hartmut die Wandergruppe im Kaffeehaus Böckeler in der Stadt angemeldet. Nach einer kleinen Cappuccino-Runde mit Apfelstrudel ging es dann weiter in die entgegengesetzte Richtung. Im steilen Treppenaufstieg zum Marktplatz stiegen wir dann auf in die Felslandschaft rund um den Battert, es wurde leicht alpin und auf schmalen und
steilen Kehren stiegen wir zwischen den Felsen hoch bis zum Felsenweg. Der Weiterweg führte uns dann vorbei an der Engelskanzel mit fantastischem Ausblick bis weit in die Rheinebene.
Die Beine wurden etwas schwerer, die Zeit lief uns davon, denn wir waren schon
weit über 6 Stunden unterwegs. So mussten wir an Tempo nochmal kräftig
zulegen, denn wir wollten nicht in die Dunkelheit reinlaufen.
Eine tolle Wanderung ging ihrem Ende entgegen. Um 18.00 Uhr waren wir
pünktlich zur Schlusseinkehr im Goldenen Löwen in Lichtental angekommen.
Danke an Hartmut Thiel unseren Wanderleiter für die tolle Tour!
Die Tourdaten: Strecke 25km, Höhenmeter ca. 950, reine Gehzeit 7 Std.45 min.
Thomas Regenold